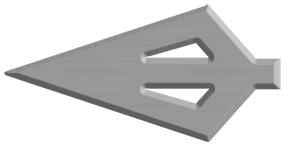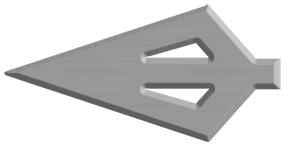|
|

Teil
7
Das "Zielen"
Man
möge mir verzeihen, daß ich hier den Ausdruck "zielen"
verwende, aber mir fiel kein besserer Ausdruck dafür ein, wie ich die
Bogenhand dazu bringe mit dem Bogen ins Ziel zu zeigen.
Beim richtigen Zielen mittels eines Visiers oder eines Referenzsystems
kenne ich, oder schätze ich die Entfernung zum Ziel. Ich ziehe den Bogen
aus, halte dann den Visierstift für diese Entfernung direkt aufs Ziel und
löse die Sehne. Habe ich die Entfernung richtig geschätzt und den
richtigen Visierstift benutzt, dann ist die Chance groß mein Ziel
punktgenau zu treffen.
Wie funktioniert dies aber beim "instinktiven" Schießen? Ich
schätze keine Entfernung, habe kein Visier oder Referenzsystem und treffe
doch mein Ziel, indem mein Bogenarm nur von meinem Gehirn unterbewußt
gesteuert wird (vorausgesetzt ich habe oft und lange genug geübt).
Sehen wir uns das bereits erwähnte Beispiel mit dem Papierkorb und dem
zusammengeknüllten Blatt Papier noch einmal etwas genauer an.
Wenn wir die Papierkugel zum aller ersten Mal in Richtung Papierkorb
werfen, ist die Chance in den Papierkorb zu treffen nicht sehr groß. Da
wir aber den Flug der Papierkugel in Richtung Korb mit den Augen
verfolgen, kann das Gehirn diese Flugbahn abspeichern. Beim nächsten Wurf
veranlaßt das Gehirn den Arm mit mehr oder weniger Kraft, abhängig von
der vorangegangenen Flugbahn, zu werfen. Mit jedem Versuch werden wir also
die Kugel näher an bzw. in den Papierkorb werfen. Voraussetzung dafür
ist allerdings, daß wir die Papierkugel im Flug sehen, und der Standort
des Papierkorbs sich nicht verändert. Stellen wir den Papierkorb in eine
andere Ecke, wird unser erster Wurfversuch wahrscheinlich wieder nicht
sehr erfolgreich sein. Mit jedem weiteren Versuch werden wir allerdings
wieder näher an bzw. in den Papierkorb treffen. Wenn wir dieses Spiel so
weiter betreiben und den Standort des Papierkorbs häufig verändern,
bildet sich unser Gehirn daraus eine Art "Vergleichstabelle".
Das bedeutet, wenn wir oft genug versucht haben aus verschiedenen
Entfernungen den Papierkorb zu treffen, merkt sich das Gehirn die
sichtbare Größe des Korbes, die dazugehörige Entfernung und die benötigte
Wurfkraft. Wenn wir dann den Korb aus irgendeiner Entfernung anschauen,
vergleicht das Gehirn die sichtbare Größe des Papierkorbs mit den
abgespeicherten Größen. Es wählt die am nächsten passende Größe aus
der "Vergleichstabelle" aus und gibt den Befehl für die zugehörige
Wurfkraft an den Arm weiter.
Beim "instinktiven" Bogenschießen läuft dieser Vorgang ähnlich
ab. Wir konzentrieren uns auf unser Ziel, spannen den Bogen, lassen unser
Gehirn unterbewußt den Bogenarm steuern und lösen die Sehne. Unser
Gehirn registriert dabei die Größe des Ziels, die Flugbahn des Pfeils
und die Stellung des Bogenarms. Sollte der Pfeil zu kurz fliegen, merkt
sich das Gehirn, daß bei einer Entfernung, die dieses Ziel in dieser
Größe erscheinen läßt, der Bogenarm etwas höher gehalten
werden muß. Das kann allerdings nur geschehen, wenn wir mit den Augen die
Flugbahn des Pfeiles verfolgen können.
Bei meinen Pfeilen verwende ich deshalb nur helle leuchtende Farben, wie
weiß, gelb und leuchtgelb bei der Befiederung. Da ich meine Federn außerdem
gedrallt aufklebe, sind meine Pfeile sehr gut sichtbar und ich kann die
Flugbahn meiner Pfeile sehr leicht verfolgen. Außerdem ist die
Trefferlage auf dem Ziel sehr leicht zu erkennen. Viele
Schützen verwenden dunkle oder gestreifte Truthahnfedern zur
Befiederung ihrer Pfeile. Diese Pfeile sehen zwar sehr gut aus, haben aber
für "instinktive" Schützen folgenden Nachteil. Sie sind sehr
schwer im Flug und auf der Scheibe zu erkennen. Dadurch erschweren diese
Schützen ihrem Gehirn die Arbeit, die Flugbahnen und Trefferlagen im Verhältnis
zu der Scheibengröße abzuspeichern. Das heißt allerdings nicht, daß
Schützen, die dunkle Befiederung bevorzugen, keine guten
"instinktiven" Schützen werden können.
Die Abspeicherung erfolgt bei ihnen aber erst ab dem Zeitpunkt, ab dem der
Pfeil fürs Auge sichtbar wird, also manchmal erst beim Ziehen der Pfeile.
Deshalb ist diese Art der Abspeicherung und die Erstellung der
"Vergleichstabelle" für das Gehirn meist eine langwierige
Angelegenheit.
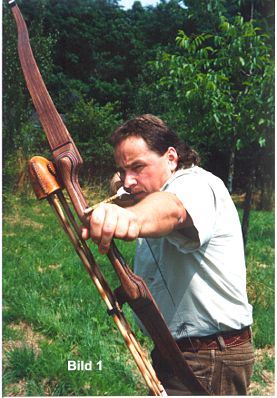 Ich empfehle jedem, der anfängt "instinktiv" zu schießen, die
Verwendung von leuchtender, sichtbarer Befiederung und hellen Nocken, um
dem Gehirn die Abspeicherarbeit so leicht als möglich zu machen.
Ich empfehle jedem, der anfängt "instinktiv" zu schießen, die
Verwendung von leuchtender, sichtbarer Befiederung und hellen Nocken, um
dem Gehirn die Abspeicherarbeit so leicht als möglich zu machen.
Ein anderer wichtiger Punkt ist die Konzentration auf das Ziel. Wenn ich
beispielsweise einen Holzwolle-Ballen mit einem dunklen Müllsack abhänge
und nur einen leuchtfarbenen Aufkleber, in der Größe eines Fünfmarkstückes,
darauf anbringe, habe ich einen sehr gut sichtbaren Punkt auf den ich mich
konzentrieren kann. Aus einer Entfernung von ca. 15 Metern sehe ich nur
diesen Punkt, da durch den dunklen Müllsack als Hintergrund mein Blick
nicht abgelenkt wird. Wenn ich nun versuche diesen Punkt zu treffen, habe
ich damit keine Schwierigkeiten, weil meine Konzentration nur auf diesem
Punkt gerichtet ist. Klebe ich jedoch mehrere Punkte dazu, fällt es mir
sehr viel schwerer mich auf einen dieser Punkte mit voller Intensität zu
konzentrieren, da mein Blick durch die anderen gleichaussehenden Punkte
abgelenkt wird. Dementsprechend fällt dabei auch mein Schießergebnis
aus. Das gleiche Experiment kann man auch bei einer sehr weiten Entfernung
machen, indem man auf einem frisch gepflügten Feld einen weißen
Styroporklotz oder ähnliches platziert. Wenn man nun ca. 100 Meter zurückgeht
und sich auf den Klotz konzentriert, fällt dies sehr leicht, weil dieser
sich vom braunen eintönigen Untergrund des Feldes sehr gut abhebt. Nach
zwei bis drei Schüssen auf den Klotz, kommt man ihm bereits sehr nah,
bzw. trifft ihn auch. Und das obwohl der Klotz ca. 100 Meter entfernt
steht. Stellt man diesen Klotz allerdings auf eine bewachsene Wiese mit
Blumen, Unkraut usw. dann fällt es sehr schwer sich auf diesen Klotz zu
konzentrieren, weil das Auge durch viele Gegenstände im Blickfeld
abgelenkt wird. Der gleiche Klotz ist dann bei der gleichen Entfernung
kaum noch zu treffen. Aus diesen Beispielen kann man erkennen, daß die
Intensität der Konzentration auf das zu treffende Ziel maßgeblich für
das Treffen des Zieles verantwortlich ist. Dies ist auch der Grund, warum
viele "instinktive" Schützen weniger Probleme haben, Scheiben
auf kurze Distanzen zu treffen, als Scheiben auf lange Distanzen. Bei den
Scheiben auf den kurzen Entfernungen fällt es viel leichter sich auf
einen Punkt dieser Scheibe zu konzentrieren, sei es ein Farbfleck, ein
bereits vorhandenes Einschußloch, die Oberflächenstruktur bei 3-D
Tierscheiben oder ähnliches. Auf den langen Distanzen sieht man die
Scheibe als ganzes, kann keine Farbflecken und keine Oberflächenstruktur
mehr erkennen und es fällt sehr schwer sich einen Punkt zu suchen.
Wenn ich mich auf einen Punkt auf der Scheibe konzentriere dann
verschwimmt für mich im Idealfall alles außer diesem Punkt. Dazu ist
aber eine sehr große Intensität an Konzentration notwendig. Diese
Intensität läßt dann meist im Laufe eines Turniers nach und die
Trefferquote verschlechtert sich. Bedingt durch die aufzubringende
Konzentration ist es für "instinktive" Schützen meist
einfacher eine "Hunter-Runde" mit einem Pfeil pro Scheibe zu
schießen, weil dabei die Intensität der Konzentration bei fast allen
Scheiben gleich bleibt, als eine normale Runde mit beispielsweise drei
Pfeilen pro Scheibe.
Ein anderes Problem stellt die Art der Scheiben für einen
"instinktiven" Schützen dar. Wer nur auf 3-D Scheiben
trainiert, erstellt sich im Gehirn eine "Vergleichstabelle" mit
der wahren Größe der Tiere. Das bedeutet, das Auge erfaßt die Größe
des 3-D Tieres und das Gehirn vergleicht die sichtbare Art und Form des
Tieres mit den gespeicherten Werten von vergleichbaren Tieren, die bei
einer bestimmten Entfernung dieselbe Größe haben. Daraufhin steuert das
Gehirn den Bogenarm auf die Höhe, die für diese Entfernung notwendig
ist. Schießt dieser Schütze allerdings dann auf Tierscheiben aus Papier,
auf denen das Tier in einer verkleinerten Fotografie abgebildet ist, dann
entsteht für das Gehirn eine "optische Täuschung". Denn das
Gehirn vergleicht die sichtbare Größe dieses Bildes mit den
abgespeicherten Werten von vergleichbaren Tieren, die aber in ihrer
Originalgröße abgespeichert wurden. Das Tier auf dem Bild scheint für
das Gehirn somit in einer weiteren Entfernung zu stehen, als dies tatsächlich
der Fall ist. Eine hohe oder sehr hohe Trefferlage ist dann meist die
Folge. Wer also als "instinktiver" Schütze bei Turnieren vorne
mitschießen will, muß auf möglichst viele unterschiedliche Scheiben
trainieren, um seinem Gehirn die Möglichkeit zu geben eine möglichst große
"Vergleichstabelle" anzulegen.
 Damit wir die Möglichkeit haben uns voll auf unser Ziel zu konzentrieren
und nicht durch irgendwelche Gegenstände in unserem Blickfeld abgelenkt
werden ist es sinnvoll den Bogen seitlich abzukippen. (Bild
1) Dabei wird der obere
Wurfschenkel, bei einem Rechtshandschützen, nach rechts geneigt. Die
meisten Schützen neigen ihren Bogen ca. 20 bis 30 Grad. Man muß auf
jeden Fall beachten, daß man die Zughand in gleichem Maße mitkippt, um
ein Verkanten der Sehne beim Ausziehen zu vermeiden. Durch das Abkippen
des Bogens hat man außerdem die Möglichkeit den Kopf etwas nach vorne über
den ausgezogenen Pfeil zu neigen. (Bild
2) Der Pfeil kommt somit näher an das Auge, das ja den hinteren Teil
unseres "Visiers" darstellt. Außerdem wird es einfacher, bei
gekipptem Bogen, die Pfeilflugbahn zu verfolgen. Manche kippen den Bogen
bei kurzen Schüssen etwas mehr als bei langen Schüssen, andere behalten
den Winkel bei allen Entfernungen bei. Bei einem Bogen, der vom "shelf"
also vom Griffstück geschossen wird, verändert der Winkel des Kippens
die Lage des Pfeils nur unwesentlich. Daher kann der Winkel ganz nach
persönlichem Geschmack gewählt, verändert oder beibehalten werden ohne
eine Veränderung der Trefferlage zu bewirken. Bei hochgesetzter
Pfeilauflage verändert das Abkippen des Bogens auch die Lage des Pfeils
erheblich. Je mehr der Bogen nach rechts gekippt wird, desto mehr
verschiebt sich die Lage des Pfeils nach rechts und nach unten. Ein Schütze,
der seinen Bogen mit hochgesetzter Pfeilauflage schießt, sollte deshalb
den einmal gewählten Winkel des Abkippens nicht von Schuß zu Schuß verändern,
da das Gehirn nicht die Möglichkeit hat diese Lageänderung so schnell zu
korrigieren.
Damit wir die Möglichkeit haben uns voll auf unser Ziel zu konzentrieren
und nicht durch irgendwelche Gegenstände in unserem Blickfeld abgelenkt
werden ist es sinnvoll den Bogen seitlich abzukippen. (Bild
1) Dabei wird der obere
Wurfschenkel, bei einem Rechtshandschützen, nach rechts geneigt. Die
meisten Schützen neigen ihren Bogen ca. 20 bis 30 Grad. Man muß auf
jeden Fall beachten, daß man die Zughand in gleichem Maße mitkippt, um
ein Verkanten der Sehne beim Ausziehen zu vermeiden. Durch das Abkippen
des Bogens hat man außerdem die Möglichkeit den Kopf etwas nach vorne über
den ausgezogenen Pfeil zu neigen. (Bild
2) Der Pfeil kommt somit näher an das Auge, das ja den hinteren Teil
unseres "Visiers" darstellt. Außerdem wird es einfacher, bei
gekipptem Bogen, die Pfeilflugbahn zu verfolgen. Manche kippen den Bogen
bei kurzen Schüssen etwas mehr als bei langen Schüssen, andere behalten
den Winkel bei allen Entfernungen bei. Bei einem Bogen, der vom "shelf"
also vom Griffstück geschossen wird, verändert der Winkel des Kippens
die Lage des Pfeils nur unwesentlich. Daher kann der Winkel ganz nach
persönlichem Geschmack gewählt, verändert oder beibehalten werden ohne
eine Veränderung der Trefferlage zu bewirken. Bei hochgesetzter
Pfeilauflage verändert das Abkippen des Bogens auch die Lage des Pfeils
erheblich. Je mehr der Bogen nach rechts gekippt wird, desto mehr
verschiebt sich die Lage des Pfeils nach rechts und nach unten. Ein Schütze,
der seinen Bogen mit hochgesetzter Pfeilauflage schießt, sollte deshalb
den einmal gewählten Winkel des Abkippens nicht von Schuß zu Schuß verändern,
da das Gehirn nicht die Möglichkeit hat diese Lageänderung so schnell zu
korrigieren.
Das Lösen der Sehne
Viele Schützen, mit denen ich mich unterhielt, erzählten mir, das
saubere Lösen der Sehne sei für sie das größte Problem überhaupt und
die häufigste Fehlerquelle für ihre schlechten Schüsse. Das Verreißen
der Zughand zur Seite wurde mir dabei als häufigste Ursache für einen
verpatzten Schuß genannt. Ich glaube jedoch das Problem vieler Schützen
ist nicht das Lösen selbst, sondern bereits der Bewegungsablauf vor dem Lösen.
Dieser Bewegungsablauf stellt sich uns folgendermaßen dar. Mit der
Bogenhand drücken wir den Bogen in Richtung Ziel und ziehen mit der
Zughand die Sehne nach hinten. Zum Lösen der Sehne werden einfach die
Finger der Zughand geöffnet und durch den Druck auf den Bogen nach vorne
wird die Sehne gerade nach vorne von den Fingern gezogen. Dies wird außerdem
durch die Bewegung der Zughand nach hinten begünstigt.
Auch wenn man die Zughand am Ankerpunkt für kurze Zeit anhält, muß man
den Druck auf den Bogen und den Zug an der Sehne beibehalten. Man kann
sich das am besten vorstellen, als stünde man in einem Türrahmen, die
Bogenhand drückt gegen die eine Seite der Zarge und der Zugarm drückt
mit dem Ellbogen gegen die andere Seite. Auch wenn sich beide Hände nicht
mehr bewegen, behalte ich den Druck auf den Bogen und den Zug an der Sehne
bei. Denn nur so kann ich sicherstellen, daß die Sehne beim Lösen gerade
nach vorne von den Fingern gezogen wird.
Viele Schützen, die ich beobachtet habe, ziehen den Bogen aus bis zum
Ankerpunkt, fangen dann an sich zu konzentrieren (oder zielen...),
behalten den Druck auf den Bogen und den damit zusammenhängenden Zug an
der Sehne aber nicht bei. Erkennbar ist dies daran, daß die Pfeilspitze
sich ganz langsam nach vorne bewegt und die Schultern langsam nachgeben.
Durch die nachgebende Schulter wird der Zug an der Sehne nach hinten nicht
beibehalten und beim Lösen der Sehne wird meist die Hand nach der Seite
vom Gesicht weggerissen. Dieses Wegreißen hat auch ein Verreißen des
Bogenarms auf die entgegengesetzte Seite zur Folge, was das Problem des
schlechten Lösens noch verschlimmert. Wer Probleme mit dem seitlichen
Wegreißen der Zughand hat, sollte auf jeden Fall erst einmal versuchen
den Druck auf den Bogen und den Zug an der Sehne aufrecht zu erhalten und
in den Schultern nicht nachzugeben. Das Problem des schlechten Lösens
wird oftmals damit schon behoben.
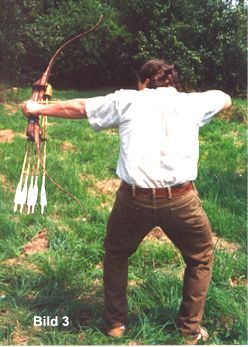 Das Einsinken in die Knie Das Einsinken in die Knie
G.Fred Asbell beschreibt in seinen Büchern "Instinctive Shooting I
und II" das Einsinken in die Knie, während des Ausziehens des
Bogens, als Intensivierung der Konzentration auf das Ziel.
Er führt auch ein Beispiel an, bei dem wir dies für uns selbst
nachvollziehen können. Wir stellen uns aufrecht hin und zeigen mit dem
Zeigefinger der rechten Hand auf einen Gegenstand. Jetzt schauen wir über
den Zeigefinger hinweg auf den Gegenstand und versuchen uns auf diesen
Gegenstand zu konzentrieren. Wenn wir nun in die Knie sinken und den Kopf
leicht nach vorne neigen schauen wir viel dichter über den Finger hinweg
auf den Gegenstand und die Konzentration wird intensiver. Der ganze Körper
wird durch das Einsinken in die Knie auf diesen Gegenstand focusiert.
Beim "instinktiven" Schießen beginnt das Einsinken in die Knie
synchron mit der Aufwärtsbewegung des Bogenarms und endet, wenn die Knie
etwa über den Zehenspitzen stehen. Ich habe diese Stellung der Knie beim
"instinktiven" Schießen ausprobiert und muß sagen, daß sie
mir vor allem dann hilft, wenn die Intensität meiner Konzentration nachläßt.
Der einzige Nachteil dieser Stellung und wahrscheinlich auch der Grund dafür,
daß so wenige Schützen diese Stellung nicht benutzen ist auf
Bild 3 zu erkennen. Man
sieht aus als hätte man gerade in die Hosen gesch....n.
Als ich im Juni ´96 beim Turnier in Cloverdale in Indiana mitgeschossen
habe und während des Ausziehens in die Knie einsank wurde ich spöttisch
gefragt ob ich das "G. Fred Syndrom" habe.
Trotz des etwas seltsamen Aussehens dieser Stellung und des Spottes, dem
sich der Schütze evtl. aussetzt, möchte ich jedem angehenden
"instinktiven" Schützen raten diese Stellung für sich einmal
zu probieren. Vielen wird es wahrscheinlich als Konzentrationshilfe zugute
kommen.
Wer gern in dieser Stellung schießt, aber bei Turnieren Angst hat
deswegen verspottet zu werden, sollte sich den Rat von G. Fred zu Herzen
nehmen sich immer in eine Gruppe mit hübschen Frauen einteilen lassen.
Passanten und andere Schützen werden dadurch von der etwas seltsamen
Haltung abgelenkt.
- Ende -
©
R.Blacky Schwarz
|
|